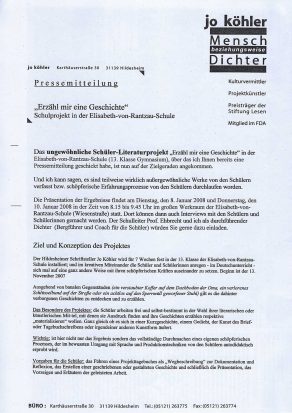Elisabeth-von-Rantzau-Schule
Schulprojekte von 1997-2008
Menü
Zukunftsvisionen 1999



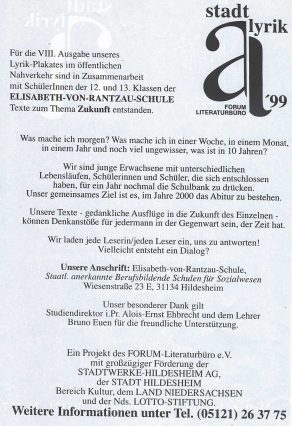
Menschen… Kinder 2004-2005
Menschen zuhören und erzählen lassen, auf der Suche nach Geschichten
Schüler der Elisabeth-von-Rantzau-Schule recherchieren und materialisieren Persönliches von Menschen in ihrer Umgebung. Unter Anleitung des Hildesheimer Dichters Jo Köhler werden die Schüler zu Geburtshelfern von Gedanken und Erinnerungen und die Schule zu einer Entdeckungsreise. „Da nimmt man sich etwas vor und dann wird auf einmal was ganz Anderes daraus!“, kommentiert Mitschüler Adrian Wunstorf die Crux seiner Erfahrung mit diesem Projekt. Dabei stoßen die Schüler auf Bekannte und Verwandte in ihrem eigenen Umkreis, machen Zufallsbekanntschaften auf der Straße oder schwärmen aus in Altenheime, Frauenhäuser und Strafanstalten. Die in Interviews und Gesprächen überlieferten Lebensgeschichten werden im wahrsten Sinn des Wortes „plastisch“ gemacht und zu Anschauungsobjekten, selbstgedrehten Filmen und szenischen Darstellungen weiterverarbeitet. „Nicht nur die Informationen sondern auch die Emotionen von Zeitzeugen geschichtlicher Ereignisse sind zwingend notwendig, um Geschichte zu begreifen!“, betont Mitschüler Rahman Rasaki.
Der Ausflug aus dem Schulalltag in die Unabhängigkeit einer künstlerischen Arbeitsform war für alle Beteiligten ein völlig neues und lehrreiches Erlebnis und löste bei Schülern und Lehrern nicht nur viele Frage sondern auch überraschende Antworten aus. „Es war nicht einfach sich selbständig organisieren zu müssen, wenn man es nicht gewohnt ist, aber ich empfinde es als eine gelungenen Vorbereitung für das Studium!“, erklärt Tolga Hircin. „Und es ist schon faszinierend zu erleben, mit welchem Ehrgeiz und welcher Leidenschaft die jungen Leute der so oft gescholtenen Schülergeneration arbeiten können, wenn man sie erst mal machen und somit spüren lässt, was es für sie selber bedeuten kann!“, sagt Dichter Jo Köhler, der gemeinsam mit Schulleiter Prof. Alois Ernst Ehbrecht das Projekt initiiert hat.




Downloads
Die entstandenen Texte
Lara
Birgit Sternberg und Anne Bartneck recherchieren die Geschichte einer jungen Frau namens Lara (Name wurde geändert). „Das Thema haben wir gewählt, da es uns sehr interessiert und weil man immer denkt, so was ist zwar tragisch, aber „Mir passiert so etwas nicht“. Plötzlich geschieht „es“ doch in unmittelbarer Nähe im eigenen Freundeskreis.
Laras Freunde warteten und warteten, doch Lara kam nicht. Als sie zu ihrer Wohnung gingen, bemerkten sie ungewöhnlich viel Polizei. Als sie ankamen, entdeckten sie Lara zwischen Polizisten weinend am Boden zerstört. Die Haare waren zerzaust und sie hatte einen blau angelaufenen Arm.
„Ich kam nach Hause, wollte mich nur kurz umziehen, aber das Flurlicht ging. Dabei bemerkte ich, dass da doch jemand in meinem Schlafzimmer stand. Vor Schreck wollte ich die Tür wieder schließen, aber dieser Jemand griff nach meinem Handgelenk und packte derbe zu. Mein Herz pochte, Panik überkam mich. Ich weiß nicht wie, aber ich schaffte es mich loszureißen. Dieser Jemand folgte mir und versuchte mich erneut zu fassen, da stürzte er auf der Treppe und ich bekam einen Vorsprung.“
Die Polizisten entdeckten in Laras Schlafzimmer ein Bügelbrett mit einem Handtuch, unter dem sich eine Riesenauswahl verschiedenster Messer, Scheren und Skalpelle befand. Daneben lag zerschnitte Unterwäsche von Lara.
Endprodukt: Rekonstruktion eines Tatortes. Das Publikum betritt einen leeren Raum, in dem sich nichts anderes befindet als ein Bügelbrett mit zusammengefalteten Handtuch und den Messern darunter. Nach der Verdunkelung des Raumes wird aus dem Erleben von Lara zitiert.
Scherenschnitt
Lesandra Ertelt recherchiert.
Sie sagte, dass ihr Stiefvater etwas Schlimmes getan habe, aber sie dürfe mit niemanden darüber sprechen. Als ich fragte, wie schlimm diese Angelegenheit wäre, sagte sie mir, dass es so schlimm sei, dass sie den Hund und das Haus verlieren würden, wenn es jemandem erzählt. Ich verstand das nicht und fragte weiter nach. Typisch in diesem Fall ist, dass ein naher Angehöriger der Täter ist und der sexuelle Missbrauch innerhalb der Familie gedeckt wird.
Umsetzung: Herstellung eines Scherenschnittes vom missbrauchten Kind aus schwarzem Karton und Anbringung des scheinbar unsichtbaren nur unter Schwarzlicht lesbaren Textes, mit dem das Kind den erlebten Missbrauch mit eigenen Worten schildert.
Mir hat dieses Deutschprojekt in vielerlei Hinsicht neue Erfahrungen gebracht, die ich zu Beginn nicht erwartet habe. Ich war eher skeptisch und bin „unterwegs“ ganz unerwartete Wege gegangen. So wollte ich zuerst Interviewpartner aus dem Freundes- und Bekanntenkreis heranziehen. Dann allerdings kam die Wendung. Statt, dass ich einer Geschichte hinterherlief, kam die Geschichte zu mir. Und wenn ich es mir genau überlege, hat jeder Mensch eine Geschichte von sich zu erzählen. Meist hält man sie aus Scham zurück oder glaubt, sie sei nicht spektakulär genug. So kam ich mir zeitweise wie ein Detektiv vor, der im Verborgenen herumstöbert.
In einem Punkt bin ich mir besonders bewusst geworden. Unsere Lebensgeschichten sind gleichzeitig unser Kulturerbe. Geschichten festzuhalten, heißt auch Geschichten an unsere Nachkommen zu überliefern.
Träume
Christina Vinke recherchiert die Geschichte eines Schwarzafrikaners in Hildesheim
Die Zeit der Recherche war für mich persönlich eine zeitaufwendige, aber auch sehr interessante Phase. Es war eine Zeit, in der ich mich auch immer wieder mit mir selbst auseinandersetzen musste. Ich habe mich immer wieder gefragt, wieso geben so viele ihre Existenz, ihre Familie und ihre Freunde auf, nur um nach Europa zu gelangen. Was versprechen sie sich davon? Diese Frage wurde ähnlich wie in einem Mosaik immer mehr beantwortet. Meine heutige Antwort lautet: „Denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Diejenigen, die herkommen wissen nichts. Die meisten kommen hier her mit einem Sack voll Träume… einfache Träume! Der Traum von Arbeit, einem Haus, einem Auto, einer Frau und Familie. Sie haben noch nie etwas gehört von Asylanträgen oder Arbeitserlaubnissen. Sie wissen gar nicht, dass sie hier nicht arbeiten dürfen! Und was passiert dann? Diese Menschen, die immer gearbeitet haben, die immer im Verbund mit anderen gelebt haben, mit Familie und Freunden, sind plötzlich allein. Sie wollen arbeiten, sich nützlich machen, aber stattdessen können sie nichts anderes machen, als den ganzen Tag herumsitzen.
Und sie verändern sich! Sie denken nur noch an ihre eigenen Vorteile, ziehen sogar andere Kameraden zu ihren Gunsten über den Tisch oder werden sogar kriminell. Etwas, woran sie in ihrer Heimat niemals gedacht hätten. Und trotzdem kommen jeden Tag neue Afrikaner mit einem Sack voller Träume.
Flußmädchen
Kathrin Lange, Sarah Lempfer, Anna Rodewald, Annie Meyer-Adam.
Man erzählte uns, dass er im Wald außerhalb der Dörfer leben würde. Sofort waren wir an diesem Menschen interessiert. Und da er sich als „Teil des Waldes“ bezeichnete, waren wir fest entschlossen, ihn und seine Geschichte auch als solchen darzustellen. So entstand die Idee einen Wasserlauf zu gestalten, der die Lebensgeschichte von Günther H. erzählt. Die landschaftlichen Gegebenheiten, die ein Fluss durchläuft, sei es eine kurvenreiche Strecke oder eine Klippe, sollten die verschiedenen Lebensabschnitte dieses Menschen widerspiegeln. Die Arbeit rund um das Projekt hat uns geprägt und gezeigt, auf welche Art und Weise man ein Leben auch ohne direkte Worte erzählen kann.
Eine der wichtigsten Fragen, die uns auf dem Herzen lag, war die, ob Günther H. nicht des Öfteren starke Sehnsucht nach der Zivilisation, dem „normalen“ Leben hätte? Diese Frage stellten wir uns immer wieder, da wir uns selbst nicht vorstellen konnten, wie es wäre immer allein im Wald zu leben? Und wie lange es wohl dauert, bis man sich an alle Geräusche des Waldes gewöhnt hat und sich nicht mehr vor jedem Rascheln fürchtet?
Wir waren von unserem Protagonisten und seiner Geschichte so überzeugt, dass wir vor Ideen nur so sprudelten. Trotz ausgiebiger Planung erfuhren wir, wie wichtig es für den Schaffungsprozess ist, sich erst einmal ein Stück weit einfach darauf einzulassen und sich von der Interaktion leiten zu lassen. Die Zusammenarbeit unter uns Vieren gestaltete sich sehr angenehm. Jeder brachte sich selbst nach seinen Möglichkeiten ein und vertraute im Gegenzug auf die anderen.
Endprodukt: Modellierter Flusslauf mit Landschaftsprofil über Wald und Berg und Tal.
(Begleittext zur Installation)
Das Leben ist wie ein Fluss
Er entsteht irgendwo
Er bahnt sich seinen Weg
Zwischen Bäumen
Zwischen Steinen
Hin
Und her
Hin
Und her
Er wird schneller
Er wird stärker
Er wächst
Bringt Steine ins Rollen
Er wird fallen
Der Abhang naht
Er fällt
Allein
Ringt nach Halt
Das Ende
Zerrissen durch Steine
Ein Anfang
Er findet sich neu
Aufgewühlt
Orientierungslos
Wie soll es weitergehen?
Von Wurzeln getragen
Langsam ebnet sich sein Weg
Gewinnt an Stärke
Fließt hin
Und her
Hin
Und her
Prägt das Ufer
Hinterlässt Spuren
Er wird ruhig
Ruhiger
Er mündet
In einen See
Sich selbst gefunden
Speist er die Wurzeln
Ist Teil des Waldes
Lebenspläne
Roland Alfus und Karsten Krämer
„Was geschieht mit den Träumen und Wünschen eines Jugendlichen im Laufe des Lebens und besonders im Krieg“. Bei der Vielzahl an Kriegen, die es in der Welt gibt, ist dieses Thema immer aktuell und wir hatten uns erst kurz zuvor über die jungen amerikanischen Soldaten unterhalten, die euphorisch in den Irak einmarschierten und überhaupt keine Ahnung hatten, was sie dort wohl erwarten würde. Auch diese „Jungs“ werden wohl Wünsche und Pläne haben.
Wir glauben, es ergeht jedem von uns so, dass man über sein Leben nachdenkt und sich Ziele setzt. Jeder hat seine geheimen oder auch nicht geheimen Träume, Wünsche und Gedanken. Der eine wünscht sich ein großes, neues Auto, der andere will mit 30 anfangen zu bauen oder was auch immer. Nur nichts verpassen! Doch was geht in einem Jugendlichen vor, der plötzlich in einen Krieg geworfen wird? Wie hätten wir in einem solchen Fall reagiert und welche Ängste und Zweifel hätten uns geplagt? Ist man sich in dieser Lage darüber im Klaren, dass das Leben in wenigen Sekunden zu Ende gehen kann und was einen erwartet? Auf diese Fragen erhofften wir uns Antworten durch unser Projekt. Dabei wollten wir nicht zu intensiv auf die Kriegsgeschehnisse eingehen sondern uns stark an die Emotionen halten.
Unser Projektpartner, Karl B. geboren am 13. April 1922 war 18 Jahre alt als er eingezogen wurde. Er war der Jüngste seiner Einheit und somit der ideale Mann für unser Thema. Geboren und aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Alfeld führte er eine einfache Landjugend, wie sie typisch war für jene Zeit.
Es wurde immer kälter, das Thermometer fiel jetzt von minus dreißig auf unter minus vierzig Grad. Der Vormarsch stoppte und alles erstarrte in eisiger Kälte. Nun begann der Stellungskrieg. Sehr tragisch war es zur Weihnachtszeit. Heiligabend sollte er Holzkreuze für seine gefallenen Kameraden anfertigen, weil er Tischler war. Gefallene lagen im Schnee und waren mit einer dicken Schneeschicht bedeckt, es herrschte große Trauer. …Da er als Oberschütze der Jüngste der Kompanie war, wurde er als Melder eingestellt und hatte die Aufgabe, dem Geschützführer die Meldungen zu bringen, da die Telefonleitungen und Funkgeräte zerstört waren. …Als er am Morgen aufwachte, hörte er eine innere Stimme zu sich sagen: „Du musst hier raus“. Erstürmte aus dem Bunker und warf seinen Mantel ab, um besser laufen zu können. Wenige Meter hinter ihm eröffneten die Russen das Feuer. …Anschließend humpelte er in einer Panzerspur zum Sanitätsbunker, der etwa 2 Km entfernt am Waldrand lag. Kurz davor brach er zusammen und schrie aus Leibeskräften um Hilfe. …Abends gab es im Lazarett Fliegeralarm, die Jagdflieger schossen durch die Fenster, keiner rührte sich oder begab sich auch nur in Deckung: „Ob heute oder morgen, wir sind eh die Nächsten“ hieß es nur lakonisch in der Truppe. Jeder hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Wünsche und Träume hatte hier keiner mehr.
Endprodukt: Eine Objektinstallation mit einem Stück Schlachtfeld aus Erde und Stahlhelm, der an einer Stelle durchschossen ist.
Und was er uns auf den Weg mitgegeben hat: „Wichtig ist Arbeit, dann hat man sein Auskommen und ist zufrieden!“ Am Wichtigsten jedoch sei die Gesundheit und der Zusammenhalt in der Familie, denn daraus und nur daraus ziehe man seine Kraft.
Hörspielgruppe
Hörspiel, Fabian Otto, Adrian Wunstorf, Tolga Hircin.
Gruppenintern haben wir uns entschieden, Personen aufzusuchen, die bereit sind, eine ihrer Lebensgeschichten zu offenbaren. Zum Festhalten des Erzählten wollten wir uns um Aufnahme mit einem Diktiergerät bemühen. Wir stellten uns vor, dass z.B. ein Patient aus dem Landeskrankenhaus vieles zu erzählen hat, da er die Wunden der Vergangenheit als Grund für seinen Aufenthalt in sich trägt. Uns war es wichtig, nicht als neugierig Fragende, sondern als Zuhörende und Zulassende einer Lebensgeschichte zu fungieren. Doch Oberarzt Dr. S., den wir mehrmals kontaktiert hatten, teilte uns mit, dass unser Vorhaben aus rechtlichen Gründen nicht durchführbar sei. Mit dem Ziel eine geeignete Person aus der Gerontologie zu finden, fuhren wir ein weiteres Mal zum LKH. Doch auch dieses Begehren lehnte man ab, da die leitende Ärztin negative Auswirkungen für die Patienten befürchtete.
Unterdessen haben wir in unserer Klasse über Kriterien für ein gelungenes Interview diskutiert. Als wichtigstes Gebot gilt das „Zuhören können“ und das Eingehen auf den Gesprächspartner, um auf diese Weise zum „Geburtshelfer“ für die Gedanken und Erinnerungen des Erzählenden zu werden.
Zitat von Jo Köhler: „Die Ohren spitzen, ganz Ohr sein, dem anderen sein Ohr leihen!“
Als weitere Institution kam uns ein Altenheim in den Sinn. Die Leiterin dort war sehr entgegenkommend und führte uns zu Gesine P., einer alten Dame, der wir unser Projekt vorstellten. Danach vereinbarten wir einen Gesprächstermin mit der 89-jährigen und verabschiedeten uns höflich. Im Interview erinnert sich die alte Dame an ihre Jugend in den dreißiger Jahren und erzählt uns von ihrer großen Liebe. Wir fragten Frau P., ob es in Ordnung sei, ein Diktiergerät mitlaufen zu lassen. Sie hatte keine Einwände. Nach dem Interview haben wir uns im Uni-Café über die Umsetzung und Gestaltung der Geschichte von Frau P. ausgetauscht.
Endprodukt: Ein Hörspiel, in dem sich die Stimme eines neutralen Erzählers mit O-Tönen aus dem Interview mit Frau P. abwechseln.
Kriegsjahre
Nina Heise
Als mein Großvater über die Kriegsjahre berichtete, wurde er sehr nachdenklich und verschlossen. Ich hatte das Gefühl, dass er mir nicht alles erzählen konnte oder wollte.
„Die Leichen wurden nach draußen getragen und übereinander neben der Kirche gestapelt!“
Später erkrankte dann auch mein Großvater, er bekam Fieber und kaum Luft. Man brachte ihn schließlich in einen kleinen Schuppen gegenüber der Kirche. Als Wachposten blieb ein Soldat der roten Armee bei ihm. Als er auf einem der Strohsäcke lag, hörte er ein Gespräch zwischen den Wachsoldaten an. Und als der jüngere von beiden sagte „Lass ihn uns erschießen, dann braucht hier niemand mehr Wache zu schieben!“ dachte mein Großvater schon an den baldigen Tod. Daraufhin gerieten die beiden in Streit, von dem mein Großvater nur Wortfetzen verstehen konnte. Der Ältere drohte schließlich den Jüngeren zu töten, falls dieser den Gefangenen erschießen würde.
„Ich konnte es nicht fassen, vor kurzem hatten wir noch aufeinander geschossen und nun hatte er mein Leben vor seinem Landsmann geschützt. Als wir alleine waren, drückte ich ihm meine Dankbarkeit aus, er sah mich nur an und nickte.“
Endprodukt: Ein von der Enkelin während des Interviews gemaltes Bild, das die Emotionen ihres Opas in Erinnerung an die Kriegsgefangenschaft wiedergeben soll. Schwarze und grüne Umrisse eines Mannes unter einem Galgen im Nacken.
In dem Projekt ging es für mich nicht nur um unentdeckte oder unerzählte Lebensgeschichten sondern auch darum, die Person, für die ich mich entschieden habe, besser kennen zu lernen. Besonders interessant war dabei, in wie weit sich der zweite Weltkrieg, aber besonders die dreijährige Gefangenschaft auf die Persönlichkeit und das Verhalten meines Großvaters ausgewirkt hat?
Krimi-Projekt 2005
Downloads
Menschen…Geschichten 2006
Downloads
Rede zum Abschluss:
Zur Frage der Benotung: Den Text von Rainer Maria Rilke, Brief am 17. Februar 1903: In soweit möchte ich euch sagen (die einzelnen Schüler dabei anschauen), jedem einzelnen von euch sagen, dass ihr die Fragen, die ihr ans Leben habt, nicht nur denken, sondern auch leben müsst, um in die Antworten… hineinzuwachsen. Nun, bei dem Studium eurer Arbeiten, Tagebücher und Menschengeschichten… autobiografischen Geschichten, hatte ich das Gefühl, dass fast alle diejenigen, die sich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auf dieses Projekt eingelassen haben (wie gesagt, nicht nur der Autor sucht sich eine Geschichte sondern auch die Geschichte sucht sich einen Autor)… …viele von Euch gespürt haben, was schöpferische Energie, das Ausschöpfen der eigenen Kräfte und Möglichkeiten (trotz oder gerade wegen aller Unsicherheiten und Widerstände) und das Gefühl, daran ein Stück zu wachsen, bedeuten kann! Also jeder einzelne von uns… wie geschaffen ist, seinerseits wiederum etwas zu schaffen… ganz gleich an welcher Stelle oder an welchem Platz im Leben… Und erst das Schöpferische, das Kreative an sich – die Kraft ist, mit der man die Dinge des Lebens, die Träume und Wünsche… vom Himmel auf die Erde holen… und etwas in die Welt setzen kann, was vorher noch nicht da war! Eine Kraft, durch die das Leben erst werden… und glücken kann, was es ist!
Erzähl mir eine Geschichte 2007-2008

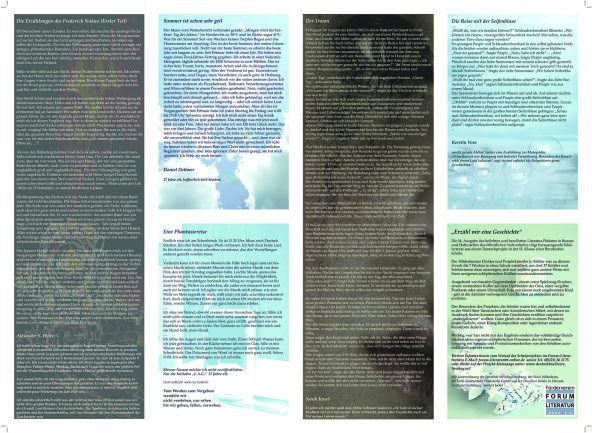
Die Entstandenen Texte
HIT
von Benjamin Lentz
Es ist Samstag. Ein schöner Tag, Auswärtsspiel gegen Stuttgart und nachher schön Sportschau gucken, wie es Millionen von Primitivlingen in Unterhemd und Trainingshose auch machen. Um abschalten zu können. Mit Bier. Wer kann das nicht?!
Aber erst noch mal Einkaufen. Mit meiner Freundin Marie.
Vor dem Einkaufszentrum halte ich ihn Locker zwischen meinem linken Zeigefinger und Daumen. Er ist abgewetzt und hat seine besten Zeiten hinter sich. Verständlich, immerhin habe ich ihn schon seit mindestens sieben Jahren. Die Kanten sind abgeschliffen und höchstwahrscheinlich voller Bakterien. Aber was soll’s, ich brauch ihn nun einmal, sonst bekomm ich nichts mehr zu Essen.
Hit steht drauf. Hit, was ist Hit überhaupt?! Ich habe mir noch nie richtige Gedanken darüber gemacht. Na ja, jetzt auch nicht.
Irgendeine Firma, die sich von einer solchen Marketingstrategie viel Umsatz erhofft, indem Leute die Aufschrift hinterfragen. Blödsinn. Für die meisten und auch für mich ist es einfach nur ein Einkaufswagenchip, mehr nicht. Also rein damit.
Einkaufen, wofür eigentlich?! Zum Überleben, na gut, die Zeiten des Jagens sind nun wirklich schon länger vorbei. Außer für solche, die gefallen am töten von Tieren finden und das zu ihrem Hobby machen. In dunkelgrünen Lederkleidern, die Socken sichtbar bis fast über die Oberschenkel gezogen und einen Hut auf dem Kopf, sitzen sie in einer aus Holz gebauten Hundehütte auf Stelzen. Warten manchmal stundenlang um dann doch gefrustet nach Hause zu gehen, weil es einfach zu kalt ist und „das blöde Wild heute nicht so richtig wollte“.
Klar, keiner stirb gerne.
Aber geht man nicht auch einkaufen, um unter Leuten zu sein, die Anwesenheit anderer Personen mit zu bekommen, ohne sich mit jemandem unterhalten zu müssen?! Ich jedenfalls gehe gerne einkaufen, also nahrungstechnisch gesehen. Klamotten lassen sich dank des neuen Zeitalters auch über das weltweite Netz beziehen und bezahlen.
Natürlich gehe ich auch gerne mal durch die Stadt und probiere das ein oder andere Teil an. Es sei denn meine Freundin ist dabei.
Ständig wird man überversorgt mit neuen Klamotten, die man „doch mal anprobieren“ soll. Ich weiß aber, was mir gefällt und welche Größe ich habe. Da muss man doch nicht noch alles Zehn mal anprobieren, nur weil es eine andere Farbe hat. Und wenn dann das richtige gefunden wurde geht man nach Hause und bestellt es sich über das Internet. Es ist einfach billiger und die Sachen kommen, ohne sie selbst in schweren Plastiktüten tragen zu müssen nach Hause. Meine Freundin aber nörgelt den ganzen restlichen Tag rum, weil sie nichts gefunden hat und „das ist immer so!“.
Und um diesen ganzen Stress und das fast unerträgliche Generve nicht mitbekommen zu müssen gehe ich doch lieber alleine Geld ausgeben.
Das einzige, was mit meiner Freundin noch erträglich ist, ist das Einkaufen von Lebensmitteln. Da hab ich meinen Einkaufswagen und sie die Ideen.
Meinen Einkaufswagen, nur weil ich meinen Hit-Einkaufschip mit dem Marktwert von einem Euro in den Schlitz gesteckt habe denke ich schon, dass es mein Wagen ist.
„Das Eigentum anderer ist Unantastbar“ hat mein Vater mir früher immer versucht beizubringen, nur weil ich mal ein Spielzeugauto mitgenommen habe und nicht gerade bereit war dafür mein weniges Taschengeld hin zu legen. Aber das ist schon lange her. Ich halte mich nun weitestgehend an seine Worte, habe in all den Jahren viel dazu gelernt. Nicht unbedingt in der Schule und auch nicht unbedingt das, was mein Vater erwartet hat. Aber einen gewissen Gerechtigkeitssinn habe ich schon entwickelt. Und ich zahle auch für Dinge, die ich brauche.
Früher war Einkaufen schon etwas anderes. In dem kleinen 5000-Einwohner-Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir gerade mal zwei Einkaufsmöglichkeiten. Neben einem Pennymarkt, der seine besten Zeiten schon lange hinter sich hatte, gab es noch „Allfrisch“, einen Markt, den ich in meinem ganzen Leben nie wieder gesehen habe. Das war auch der einzige Einkaufsmarkt, den ich ein Jahr mit meinem damaligen besten Freund nicht betreten durfte, weil ich mich wieder nicht an die Worte meines Vaters gehalten hatte. Dabei war es ein ziemlich guter Plan um sich Tictac anzueignen. Bevor wir in den Markt hineingingen holten wir uns beim dazugehörigen Bäcker ein Brötchen, da diese Tüten in denen die Brötchen lagen an der Kasse eigentlich nie kontrolliert wurden.
Wurden sie auch nicht. Aber von den kleinen Löchern zwischen den Regalen wusste zu dieser Zeit nur der Ladendetektiv. Pech!
Nach drei Monaten konnten wir zwar wieder in unserem Lieblingsladen einkaufen, aber den Ruf der ungezogenen Lehrerkinder hatten wir nun bei den älteren Herrschaften des Dorfes weg.
Auf dieses kleine Vergehen folgten möglicherweise auch noch einige andere Jugendsünden die zu unserem Ruf beitrugen. Und dazu, dass wir später nicht in diesem „hoffnungsloses Scheißkaff“ leben wollte.
Back in Town. Der Einkaufswagen wird voller. Ich stehe vor der Obst- und Gemüseabteilung. Meine Freundin wuselt darin herum. Ich warte lieber. Es kommt mir vor wie eine halbe Stunde, die ich nun schon da stehe, jedoch sind erst zehn Minuten vergangen.
Sie ist ein hübsches Mädchen. Aber ich bin schon sehr lange mit ihr zusammen. Vielleicht auch schon zu lange. Ihre ganzen Macken, die ich zu Beginn der Beziehung noch als so amüsant empfand, sind nun zu Dingen geworden, die sehr belastend und peinlich sind. Und das nicht nur für mich.
Marie denkt anders übers Einkaufen. Sie ekelt sich vor streng riechenden „Idioten“ mit fettigen Haaren, beschimpft in ihren Gedanken jede Person, die ihr auch nur ein paar Zentimeter im Weg steht. Es scheint mir schon langsam so, als ob sie nur negativ auf ihr Umfeld eingestimmt ist. Sie hat nie Lust neuen Leuten zu begegnen. Auf Partys geht sie immer mit der gleichen Voreinstellung: „Die sind doch eh alle scheiße da!“
Sie kommt wieder. „Wollen wir Möhrchen in den Auflauf schnibbeln?!“ fragt sie mich allen ernstes. Ich lache etwas und antworte ihr mit einem trockenen „Nein!“. Dabei nimmt mein Gesicht wieder einen ausdruckslosen Zug an.
Um sie nicht ganz stark zu kränken, stimme ich ihr zu am nächsten morgen einen Obstshake zu trinken. Wohl wissend, dass ich keinen Obstshake trinken werde. Ich muss mir nur noch Überlegen, welchen Ausweg es gibt.
Von meinem Platz aus habe ich einen guten Überblick. Ein Pärchen steht gerade vor irgendeinem Grünzeug. Er ist groß, hat einen langen Mantel mit hochgestelltem Kragen an und eine dunkelgrüne Umhängetasche um. Der einmal um seinen Hals gewickelte Schal passt genauso zu dem Mantel, wie seine Handschuhe, die er trotz gefühlten 35°C trägt. Seine abgetretenen Sneaker passen auch zu seiner extrem kartoffelbraunen Korthose. Man könnte schon den Ausdruck „Student“ für ihn benutzen.
Sein Freundin, ich erkenne es daran, dass sie die Einkaufsliste in der Hand hält, ist auch groß aber einen Kopf kleiner als er. Sie ist keine Studentin, sieht aus wie 16 oder 17 Jahre. Jaqueline, so nennt er sie, hat dunkelrote fettig gefärbte Haare, die dem Haaransatz zu Folge schon seit mehreren Jahren keinen Frisör mehr gesehen haben.
Wahrscheinlich gehen die beiden heute Abend ins Kino, weil er will, dass seine Freunde Jaqueline nicht kennen lernen. Zu groß ist der Altersunterschied und zu unangenehm wären die Blicke auf ihm. Oder sie machen doch lieber einen „gemütlichen DVD-Abend“ mit einer heißen Milch mit Honig oder einem Tee und Studentenfutter. Das ist gesund und schmeckt.
Ihr wird er möglicherweise noch erzählen, dass er keine Lust hat etwas „partymäßiges“ zu machen. Doch in Wirklichkeit denkt er schon an das nächste Wochenende mit seinen Freunden. Und dass er dann endlich mal wieder „richtig feiern“ kann.
Als ich mich von den beiden abwende sehe ich eine, etwa einen halben Meter lange, pelzige Rinderzunge. Direkt neben mir in der Fleischabteilung. Mir kommen die Forellenstückchen mit Brot, die es an dem kleinen Stand am Eingang gab und an denen ich mich schnellst möglich maßlos ausgelassen habe, wieder hoch.
„Warum ist eigentlich die Fleisch direkt neben der Obst- und Gemüseabteilung?“, frage ich meine Freundin, die den Weg zu mir zurück gefunden hat. Aber nicht ohne etliche Plastiktüten mit grünem Inhalt. Sie beachtet mich gar nicht und ich versuche mir die Frage selbst zu beantworten. Möglicherweise ist es der Anreiz für einen sich „auf Diät“ befindenden dicken Mann, der sich, wegen seines übermäßigen Speichelflusses dann doch noch ein saftiges Steak kauft, weil er „einfach nicht widerstehen kann“.
Der Wahnsinn mit der Fresserei beginnt schon in der Vorweihnachtszeit, die für manche schon drei Monate vor Weihnachten beginnt. Dort kaufen viele schon Schokoladenweihnachtsmänner und die anderen Kalorienhaltigen Angebote. Mir soll das egal sein. Um so mehr kann ich mich mit anderen oder auch alleine über Dicke lustig machen. Natürlich ist das eigentlich nicht akzeptabel so über andere Menschen zu reden und manche können bestimmt auch nichts dafür, aber ein Großteil ist einfach nur dick, weil sie ihren fetten Arsch nicht bewegen und zu viele Kalorien in sich hineinstopfen. Es ist doch bekannt, dass sich vor allem sportlich aktive Menschen allein schon beim Treppensteigen besser fühlen.
„Schatz, kannst du die Wurst für mich umtauschen? Die sieht ekelig aus!“ schnaubt Marie. „Ja…du wirst auch noch dick, weil du dich nicht bewegst“ denke ich mir und nehme ihr wortlos die Wurst ab. Jetzt nennt sie mich sogar schon „Schatz“. Wie ich diese Anrede hasse. Vor circa drei Jahren musste ich sie jeden Tag hören, da meine damaligen Mitbewohner sich soooo sehr liebten. Heute nicht mehr. „Aus die Maus!“, wie man doch so schön sagt. Ich glaube ich muss jetzt auch Schluss machen. Es ist bald Weihnachten. Teure Geschenke kaufen, obwohl sie eh bald weg ist?! Das mach ich nicht. Dann lieber schnell Handeln.
Ganz anders der 14 jährige kleine Junge in seiner „alta, ich bin´n Gangsta alta!“ Kleidung. Schräg aufgesetzte Basecap, „Picaldi Jeans“, Bomberjacke, die ihn von hinten auch sehr breit erscheinen lässt und die in die Socken gestopfte Werbehose. Nun steht er da, blass, vor der Schmuckausstellung mitten im Einkaufszentrum und begutachtet ein Armband für 59,99 Euro. Heruntergesetzt natürlich. Außen hart, innen weich.
Seine zwölfjährige Freundin, die es den Eltern immer noch nicht erzählt hat, wird sich bestimmt sehr freuen, stolz ihren staunenden, aber im innern feindseligen Freundinnen vorzeigen „Guck mal hab ich von Jean-Luc bekommen! Cool ne!?“ und dann am Abend mit ihm schlafen. Warum auch nicht!?
Ein lautes Scheppern holt mich aus meinen Tagträumen. Ich bin gegen den Einkaufswagen eines nach Fleisch suchenden, großen, dicken Mannes gekracht. Mit einem entschuldigenden „Uuups!“, weil er sich ziemlich erschrocken hat und ich nicht schuld an seinem Tod durch Herzversagen sein will, ohne mich dafür entschuldigt zu haben, grinse ich ihn an und gehe weiter.
Ich schaue auf meine Uhr. 17.30 Uhr. Jetzt wird’s knapp. Sportschau fängt in vierzig Minuten an. Das macht mich etwas nervös und ich dränge Marie sich doch bitte etwas zu beeilen. Fehler! Jetzt sieht sie komischerweise immer mehr belangloses, was wir ja „unbedingt brauchen!“. Egal, kommt alles in den Korb. Dann geht’s schneller und sie verliert irgendwann die Lust.
Endlich ist es so weit, das Ziel ist in Sicht. Die Kasse. Meine Schritte beschleunigen sich etwas. Die Kosmetikabteilung! Schnell vorbei. Sie hat nichts gemerkt. Komisch, etwas irritierend, aber Hauptsache vorbei! Nur noch schnell zur Kasse.
Dann steht auch noch ein Typ mit seinem Wagen in meiner Fahrbahn, so dass ich nicht an die Kasse komme, an der nur eine kleinere Schlange von Konsumenten steht.
Auch wenn Jürgen von der Lippe einmal in seiner Sendung „Geld oder Liebe“, ja das ist schon lange her, gesagt hat: „Egal wie kurz die Schlange auch aussieht, wenn man sich anstellt, ist es eh wieder die längste“. Mir ist das egal, dort will ich jetzt hin! Warum soll ich denn in dieser Situation auf einen Hawaiihemden-tragenden-Nordrhein-Westfalen hören?!
Ich bitte also den, na klar was wohl, dicken Typen liebevoll ein wenig Platz zu machen.
„Ich kann auch nicht zaubern!“ entgegnet er mir.
Ein klein wenig verärgert sage ich ihm, dass er doch mal „einen kleinen Schritt zur Seite machen und seinen Wagen wegziehen“ kann.
Das einzige was ich zu hören bekomme ist ein „ruhig, junger Mann“, aber mehr passiert nicht.
Jetzt reicht es mir. Mit meinem Einkaufswagen schiebe ich seinen zur Seite, so dass er den Herren mit schweren Knochen anrempelt. Ich gehe mit einem zornigen „Danke!“ an ihm vorbei und stelle mich an der Kasse an, meine Freundin im Schlepptau.
Vor uns stehen nur noch zwei ältere Damen, die scheinbar zusammengehören, da sie sich angeregt unterhalten. Und dann ist es passiert. Dank ihrer angeregten Unterhaltung haben die beiden vergessen den Trennstab zwischen ihre Ware zu legen.
Die Kassiererin hat dann natürlich alles zusammen über den Scanner gezogen und muss nun den Kassenchef zum öffnen der Kasse holen.
Ich werde wahnsinnig, habe das Gefühl, dass mich heute alle verarschen wollen. Nach geschlagenen fünf Minuten, der Dicke an der anderen Kasse ist längst weg, kommt endlich Mr. Kassenchef höchst persönlich und öffnet die Kasse. Das war`s schon!?. Mehr musste nicht gemacht werden!?. Aber nicht einmal so was wird dem Kassierpersonal heutzutage zugetraut. Die Unruhe in und hinter mir legt sich langsam und Marie und ich sind endlich an der Reihe.
Es sind nun noch zwei Minuten bis zu unserem Glück und noch zwanzig bis zur Sportschau.
Gedichte
von Lena Maria Galbarz
Glaube an dich
und du wirst nicht scheitern.
Arbeite an dir
und du erlangst Zufriedenheit.
Gebe ohne zu nehmen
Und man wird dir Freude schenken.
Einmalig
Denn niemand hat deine Fingerabdrücke,
die du hinterlässt.
Niemand hat deine Stimme die sagt:
Ich mag dich.
Niemand wie du glaubt an seinen glauben.
Niemand wie du hat so eine Geschichte.
Niemand ist so wie du.
Niemand in deiner Stadt, in deinem Land.
Niemand.
Denn du Bist Einmalig.
Vertrauen
Vertrauen kannst du nur denjenigen,
die du glaubst zu kennen.
Doch meine nicht,
jeden der meisten zu kennen.
Kapitel
Das leben ist wie ein Buch
Es gibt viele Kapitel
Alle verschieden und doch gleich.
Manchmal musst du stark sein,
um eins zu schließen,
und eine neue Tür zu öffnen.
Innehalten
Lass dich nieder und schließe deine Augen
Verweile
Und Entdecke was in dir liegt,
tief verborgen, wie ein Schatz.
Hüte ihn,
sonst geht er dir verloren.
Meine Geschichte
Ich trage sie auf und in mir,
ein Teil nur für kurze Zeit,
aber ich ertrage sie
und mit der Zeit wachse ich mit ihr.
Eine Fantasiereise
von Carl Alexander Groß
Endlich sitze ich am Schreibtisch. Es ist 15.35 Uhr. Muss noch Deutsch machen. Ein 3 Seiten langes Werk verfassen. Ich hab dazu keine Lust. Es blockiert mich, etwas schreiben zu müssen, das den Vorstellungen anderer gerecht werden muss. Entweder schreibe ich, um eine bestimmte Note zubekommen und schreibe ohne Herz oder um etwas bestimmtes durch meine Worte auszudrücken, aber dies ohne Vorgabe an Form oder inhaltliches Thema. Heute war es sehr anstrengend in der Schule und ich bin sehr müde. Vielleicht kann ich für einen Moment die Füße hoch legen und ein bisschen Musik hören,vielleicht Mozart oder die schöne Musik von dem Film den ich mir Sonntag angesehen habe. Leichte Musik, genau das brauche ich jetzt.Musik bedeutet für mich nicht nur die Möglichkeit, durch banale Tonabfolgen berieselt den Alltag zu vergessen, sie ist für mich ein Weg Welten zu entdecken, die außer mir niemand kennt und auch nie kennen wird. Ich spüre wie die Musik mich erfasst,wie eine Welle im Meer ergreift sie mich, reißt mich mit sich,scheinbar unkontrolliert, doch zielgerichtet führt sie mich an einen Ort an dem ich nur eines fühle, weiche Wärme. Zuerst nur ganz leicht dann stärker umnachtet es mich. Ich sitze am Strand, obwohl es einer dieser friesischen Tage ist, fühle ich mich nicht einsam und es friert mich nicht, sondern umgeben von etwas das sich in Worte nicht zu fassen lässt, ganz erfüllt,geschützt wie ein Kraftfeld aus, vielleicht Liebe. Der Gedanke an Liebe berührt mich und ein Hund bellt, mein Hund. Ich sehe sie aus der Ferne auf mich zu laufen. Ich stehe auf, klopfe mir den Sand von der Hose, schaue mich um, hocke mich dann wieder hin um sie zu begrüßen. Wie immer stellt sie ihre Vorderpfoten auf mein Knie und schaut mir tief in die Augen. Fragend, wo gehen wir hin? Magst Du mit mir spielen?
Ihr Blick, der soviel Wärme ausstrahlt, und der mir doch explizit sagt was sie möchte, gibt mir eine Form von Zufriedenheit, wie in der Gegenwart eines guten Freundes. Wir gehen ein Stück am Wasser entlang, das rauschende Meer, die klare Luft, die Dünen und der Sand all die Bilderrufen alte Assoziationen hervor. Bin ich hier nicht schon vor zwanzig Jahren mit meinem Großvater spazieren gegangen? Kaum ein Wimpernschlag von meinem Gedankengang entfernt, sitze ich an der Geburtstagstafel von meinem Großvater. Ich bin elf, 1991, ich sehe so viele Gesichter, die mir damals vertraut waren. Mir gegenübersitzt ein alter Arbeitskollege von Opa, der mit mir immer gespielt hat, meine Oma versucht meine Geschwister zu ermahnen nicht soviel Krach zu machen, Tina und Pinki, die Hunde von Oma, seit fast zwanzig Jahren hab ich sie nicht gesehen, tollen gemeinsam mit meinem Bruder.Ich stehe von meinem Platz auf. Ich schaue mir alles genau aus der Nähe an. Obwohl ich Alles kenne, jede Person, jeder Gegenstand,so ist doch dieser Moment, der damals so unwichtig schien, im Moment ein Sonnenaufgang in meinem Herzen. Mit diesem Gefühl schwindet das Bild vor meinen Augen, zuerst so als würde ich durch trübes Glas blicken, dann weiß und schließlich dunkel. Niemand hier, kalt, lautlos, was passiert jetzt? Rauschen? Ein Wald. Ich stehe inmitten einer Lichtung, umgeben von Laubholzbäumen. Laubholzbäume? Jetzt erinnere ich mich, den Ausdruck haben wir doch immer im Forststudium verwendet. Die Kronen der Bäume schaukeln im Wind, sie neigen sich und richten sich auf, als ob sich versuchen würden aufzustehen aus der Knechtschaft des Windes.Ich gehe einen Weg entlang der sich vor meinen Füßen abzeichnet. Außer dem Rauschen ist Nichts zu hören, aber eigentlich erwartet man genau das, wenn man in den Wald geht. Die monotone Geräuschkulisse verstärkt meinen Blick für die Natur. Ich sehe Eichhörnchen. Zwei. Sie springen von Ast zu Ast und scheinen sich zu jagen. Ein Reh erschreckt sich durch meine Anwesenheit und flüchtet tiefer in den Wald.
Die Lichtung verliert sich hinter meinem Rücken. Es wird langsam dunkel und kalt. Ich fange an zu laufen, um schneller aus dem Wald zu finden, und um mich aufzuwärmen. Ob Eichhörnchen auch frieren? Einen kurzen Augenblick habe ich nicht darauf geachtet wohin ich laufe und stürze.Blut. Wo kommt es her? Nach kurzem Suchen stelle ich fest, dass ich mir mein Bein an einem spitzen Ast aufgerissen habe, aber ich empfinde keine Schmerzen, ich weiß wie sich diese Wunde anfühlen müsste, spüre aber nichts. Als ich gestürzt bin, hab ich wohl die Orientierung verloren. Aus welcher Richtung bin ich gekommen? In welche Richtung wollte ich gehen. Regen! Na großartig. Jetzt aber schnell. Der Regen ist so dicht, dass ich nicht durch ihn hindurch sehen kann. Ich kann nicht klar sehen. Der Regen läuft mir in die Augen. Plötzlich falle ich. Warum?Weiß ich nicht. Ich öffne die Augen und falle fast vom Stuhl. Einen Schluck Wasser kann ich jetzt gut gebrauchen. In der Küche nehme ich mir ein Glas, fülle es mit Wasser und trinke. Noch ganz benommen gehe ich zurück zu meinem Schreibtisch. Das Dokument von Word ist immer noch ganz weiß.Schon 17.00. Ich sollte mir überlegen was ich schreibe. Ich setze mich hin und lasse meine Gedanken kreisen. So viele Bilder sind in meinem Kopf, mein Hund, Strand, Eichhörnchen, alles kreist in meinem Kopf so schnell, dass kein Gedanke lange genug zu halten ist.Dieser Wirrwarr an Gedanken, Bildern und Tönen zieht mich mit sich in eine Art Strudel der so stark ist, dass ich mich ihm nur ergeben kann. Au! Meine Schwester hat mich gerade gekniffen. Wo bin ich? Ich erkenne das Haus langsam. Das Haus meiner Tante. Ich mochte sie immer sehr, nur mein Onkel war mir ein wenig zu streng. Ein lauter Knall lässt mich erschrecken und reißt mich aus dem Haus meiner Tante in meine Wohnung in Hildesheim. Timo ist gerade gekommen, er besucht wohl Rebecca. Mir ist kalt und es ist schon 24Uhr. Ich sollte schlafen gehen. Schade, dass ich heute kein Thema gefunden habe, über das ich etwas schreiben könnte.
Gedicht:
Vom Werden zum Vergehen,
wandeln wir
nicht verstehen, nur sehen
bis wir gehen, fallen, verwehn.
Sommer ist schon sehr geil
von Daniel Dettmer
Der Mann vom Wetterbericht verkündet gerade: „Morgen wird der heißeste Tag des Jahres.“ Im Norden bis zu 38°C und im Süden sogar 41°C. Was für ein Sommer! Seit vier Wochen keinen Tropfen Regen und das Thermometer am Anschlag. Das ist der beste Sommer den mein Erinnerungsvermögen rausrücken will. Nicht nur der beste Sommer, es scheint das beste Jahr seit langem zu sein. Seit Februar habe ich einen Job. Die haben mir sogar einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben. Ich arbeite in einer Industrie-Metzgerei, täglich schneide ich 2500 Schweine in zwei Hälften. Das ist sicher kein Traum; harte, monotone Arbeit und die Aufstiegschancen sind verschwindend gering. Aber der Verdienst ist gut, 1.200 netto, und Özgan, mein Vorarbeiter, ist auch ganz in Ordnung. Er ist zumindest nicht so ein Arschloch wie die vielen anderen davor. Ich hatte unter anderem als Pizzalieferant, Tankwart, Versicherungsvertreter und Filmvorführer in einem Pornokino gearbeitet. Nein, ich habe geknechtet, für einen Hungerlohn. Ich wurde ausgenutzt, man hat mich beschimpft und danach gefeuert oder ich habe gekündigt weil mir die Arbeit zu anstrengend war, zu langweilig war oder weil ich einfach keine Lust mehr hatte jeden verdammten Morgen aufzustehen. Aber all dies ist Vergangenheit. Seit Februar habe ich jeden Montag bis Freitag von 6.00 bis 15.00 Uhr Schweine zersägt. Ich hab mich nicht einen Tag krank gemeldet oder bin zu spät gekommen. Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist eine Frau. Aber bei denen habe ich seit Elli kein Glück mehr. Das war vor drei Jahren. Die große Liebe. Dachte ich. Sie hat mich mit betrogen, mich belogen und danach behauptet ich habe zu viele Fehler gemacht die unverzeihlich sind. Sie hat ihre Sachen gepackt und dann war sie weg. Seitdem haben wir kein einziges Wort mehr gewechselt. Ich habe sie immer wieder in diversen Bars und Clubs mit diversen männlichen Begleitern gesehen, aber stets ignoriert. Oder besser gesagt, sie hat mich ignoriert. Ich liebe sie immer noch.
Die Nachrichten sind vorbei. Werbung. Ich schalte die 45 Kanäle langsam durch. Langweilig, langweilig, scheiße, bloß nicht, langweilig. Ich knipse schneller weiter bis ich wieder bei Kanal eins angekommen bin. Es läuft einfach nichts. Vorsichtshalber schalte ich die 45 Kanäle noch dreimal hintereinander durch. Nachdem ich ausgerechnet hatte, das ich in den letzten vier Minuten 170 mal den gleichen Knopf der Fernbedienung gedrückt hatte und das Programm trotzdem nicht besser geworden ist, schalte ich den Fernseher aus. Aber was nun? Es ist Freitag. 12.32 Uhr. Eigentlich habe ich heute einen Tag Urlaub genommen, weil ich vom Straßenverkehrsamt meinen neuen Führerschein abholen wollte. Den alten hatte ich verloren, und da Ämter bekanntlich die vorteilhaftesten Öffnungszeiten haben, nämlich solche zu denen jeder normale Mensch arbeitet, musste ich halt einen Tag frei nehmen um dort hinzukommen. Aber da hab ich heute keine Lust drauf, es ist einfach zu heiß. Ich schwitze. Ich schwitze ja schon obwohl ich mich noch gar nicht bewegt habe. Die Jungs kann ich auch noch nicht anrufen, einige sind auf der Arbeit und die die nicht erwerbstätig sind, sind zu so früher Stunde nicht zu erreichen. Als ich das nächste Mal wach werde ist es 15.15 Uhr. Super. Ich springe gleich unter die Dusche. Danach esse ich die halbe Pizza, die von gestern Abend übrig geblieben ist. Anschließend rufe ich einige Freunde an um endlich mal unter die Sonne zu kommen. Nach vielen Versuchen erreiche ich Julian, wir verabreden uns für 16.00 Uhr am Baggersee. Dort angekommen gehen wir sofort schwimmen, wir reden über alte, bessere Zeiten, lassen uns über Frauen aus, trauern unseren Ex-Freundinnen hinterher, schmieden Pläne für den Abend und gehen alle 15 Minuten ins Wasser um die unerträgliche Hitze erträglich zu machen. Ich verabschiede mich mit den Worten: „Unglaublich das es morgen noch heißer werden soll. Und da haben wir auch noch einen Kater. Ich werde mir wünschen tot zu sein. Bis später.“ Wieder zu Hause angekommen mache ich mir einen großen Teller Spaghetti Bolognese den ich schnell aufesse. Dann gehe ich wieder duschen. Ich ziehe mir eine saubere Jeans und ein frisches T-Shirt an. Ich putze sogar meine Schuhe, das hab ich noch nie getan. Aber man muss halt auf jede Kleinigkeit achten wenn man Erfolg bei Frauen haben möchte. Ich bin fest entschlossen heute die neue große Liebe kennen zu lernen und das „Elli-Dilemma“ hinter mir zu lassen. Und das nach drei Jahren, ich bin verrückt. Dazu werden einige Biere nötig sein, also fahre ich auf dem Weg zu Julian noch bei Tengelmann&Kaiser´s vorbei und kaufe einen Kasten.
Der Rest des Abends nimmt einen erwarteten Verlauf. Wir sitzen bei Julian auf dem Balkon und trinken Bier. Es kommen immer mehr Leute dazu, bis wir etwa zu fünfzehnt sind. Jeder bringt was zu trinken mit. Mit steigender Stimmung steigt auch die Lautstärke und irgendwann gegen 23.30 rufen die Nachbarn die Polizei und die Party ist damit beendet. Es gibt einige Streitigkeiten wie wir den Rest des Abends verbringen sollen. Deshalb teilt sich die Gruppe. Ich gehe mit Julian und zwei weiteren Freunden in den Unique-Club. Es sollte sich später herausstellen, dass dies ein Fehler war. Dort angekommen trinken wir erstmal noch ein Bier an der Theke. Sofort kommen meine beiden Kumpels mit zwei Frauen ins Gespräch und verschwinden mit den beiden in der Lounge des Clubs. Jetzt bin ich wieder mit Julian allein unterwegs. Wir beschließen tanzen zu gehen, obwohl ich mich noch viel zu nüchtern fühle um wirklich tanzen zu können. Julian anscheinend nicht. Es wird gerade „Blumentopf – Party Safari“ gespielt, die Stimmung scheint auf dem Höhepunkt zu sein obwohl es erst 1.00 Uhr ist. Ich probiere so gut es geht zu tanzen, komme mir aber ziemlich beobachtet vor und verlasse die Tanzfläche schnellst möglich wieder. Ich beobachte aus sicherer Entfernung von der Theke aus, dass Julian voll in seinem Element ist und penetrant verschiedene Frauen antanzt. Eine der Angetanzten geht drauf ein. Die beiden bleiben noch zwei Lieder auf der Tanzfläche und gehen danach wohl auch in die Lounge. Ich bleibe sitzen und bestelle mir noch ein Bier. Das nächste Lied das gespielt wird ist „What’s love got to do with it“. Alle Pärchen stürmen auf die Tanzfläche oder küssen sich. Ich kriege das Kotzen. Zwei Schnaps, bitte. Schon besser. Ich rauche eine nach der anderen und gucke den Leuten dabei zu wie sie sich amüsieren. Ich fühle mich allein. Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, huscht auf einmal Elli durchs Geschehen. Damit haben sich meine hochgesteckten Ziele für heute Abend erledigt. Ich will nur noch hier weg, aber auch nicht nach Hause. Also bestell ich mir noch ein Bier und noch einen Kurzen, dann noch einen und noch einen und noch einen.
Plötzlich werde ich von der Sonne geweckt. Sie blendet mich stark obwohl meine Augen geschlossen sind. Mein Kopf droht zu platzen. Ich habe unbeschreiblichen Durst. Ich bin total nass geschwitzt, meine Kleidung ist feucht. An meinen Handinnenflächen spüre ich kleine raue Körner. Es fühlt sich an wie Sand. Wo bin ich? Am Strand? Wie bin ich hier her gekommen? Im Hintergrund höre ich Musik und Kinderstimmen. Die Musik kommt mir bekannt vor. Die CD habe ich auch „Rio Reiser – Junimond“. Langsam probiere ich meine Augen zu öffnen, es ist schwer weil die Sonne so blendet. Und es ist heiß. Gefühlte 60°C. Als ich es dann geschafft habe meine Augenlider für wenige Millimeter auseinander zu pressen, wird mir schnell klar das ich nicht am Strand bin. Zehn Meter geradeaus steht ein Klettergerüst auf dem Kinder spielen. Ich schaue mich weiter um. Jetzt habe ich begriffen wo ich bin. Auf einem Spielplatz. Auf einem Spielplatz der ca. drei Straßen von meiner Wohnung entfernt ist. Links neben mir fünf Dosen Bier, alle verschlossen. Rechts neben mir eine Flasche Doppelkorn aus der ein Schluck genommen ist und ein großer Haufen Erbrochenes, außerdem zwei Taschentücher. Ich stehe vorsichtig auf. Mir geht es schlecht. Jetzt erkenne ich auch die Musikquelle. Es ist ein Auto. Es ist mein Auto. Nein. Es fühlt sich an als wenn ich eine Stahlfaust in den Magen gerammt bekomme. Ich übergebe mich zweimal. Die Kinder gucken entsetzt zu mir rüber. Ein Rentnerehepaar das gerade vorbeigeht schüttelt mit dem Kopf. Was ist gestern nur passiert? Ich schleiche zum Auto, setze mich rein, stelle die Musik aus, schließe die Tür und kurble das Fenster hoch. Es ist 10.00 Uhr. Ich bleibe lange regungslos sitzen. Alles dreht sich. Ich bin noch immer betrunken. Mein Gewissen droht meine Nervenfasern auseinander zu reißen. Was habe ich nur getan? Ich springe aus dem Auto und gehe einmal drum herum. Alles in Ordnung, keine Kratzer, keine Beulen, Gott sei Dank. Ich setze mich wieder auf den Fahrersitz. Zehn Minuten später ist mein Puls etwas niedriger geworden. 150. Ich fahre los. Auf dem schnellsten Weg nach Hause. Ich parke das Auto auf dem verstecktesten Parkplatz den ich finden kann und gehe so schnell ich kann ins Haus, drei Etagen nach oben und dann in meine Wohnung. Ich lasse die Jalousien runter, zieh meine dreckigen Klamotten aus und lege mich aufs Bett. Ich denke an Elli, an Alkohol, an Freunde, an Autos, an Verkehrsunfälle, an Blut, an Tote, an tote Kinder, tote Tiere, an Fahrerflucht, an durchbrochene Polizeisperren, an Schüsse, an Gefängnis und viele andere Sachen. Ich nehme 20mg Valium und schlafe ein. Um 16.12 Uhr wache ich wieder auf. Jetzt bin ich nüchtern. Besser geht’s mir trotzdem nicht. Mir geht’s schlechter, mir geht’s viel schlechter. Meine Gedanken sind sofort wieder bei dem Spielplatz, bei dem Auto. Ich versuche den Abend zu rekonstruieren. Ab dem Zeitpunkt als ich Elli gesehen habe, finde ich nur noch Momentaufnahmen in meinem Gedächtnis. Ich hab getrunken, ich hab mich mit einer Frau unterhalten, hab mit einer Frau getanzt und vermutlich habe ich diese Frau auch geküsst. Ich kann mich aber nicht dran erinnern wer diese Frau war. Der Zeitraum von da an bis zum Aufwachen auf dem Spielplatz wird in meinem Kopf als schwarzes großes Loch dargestellt. Ich habe keinerlei Erinnerungen. Ich wünsche mir ich wäre tot. Dann müsste ich nicht leiden, dann müsste ich nicht ertragen das meine Gewissensbisse mich lähmen. Dann müsste ich nicht mehr denken. Aber dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung. Mein Telefon klingelt. Ich nehme nicht ab. Ich gucke auf mein Handy. 9 unbeantwortete Anrufe. Zwei sind von Julian, drei von anderen Freunden und 4 von unbekannten Anrufern. Ich denke darüber nach einen der Drei zurückzurufen und zu fragen was ich gestern Nacht getan habe. Aber mir fehlt die Kraft. Wahrscheinlich hält mich die Angst vor der grausigen Wahrheit über den gestrigen Abend von einem Rückruf ab. Ich quäle mich zur Musikanlage und lege ein Album von Otis Redding ein, wähle Lied 27: „Wonderful World“, schalte auf Wiederholung. Dann lege ich mich wieder ins Bett. Das Lied passt irgendwie gar nicht zu meinem Leben. Aber ich finde es trotzdem toll. Deshalb höre ich es in der nächsten Stunde immer und immer wieder. In der Zeit klingelt das Telefon noch vier Mal. Vier Mal unbekannter Anrufer. Ich bin neugierig wer probiert mich zu erreichen, traue mich aber nicht abzunehmen. Es vergehen zwei weitere Stunden in denen sich meine Gedanken im Kreis drehen. Jetzt reicht es mir. Ich muss näheres wissen. Ich rufe Julian an. Der hört sich auch nicht gerade frisch an. Aber er scheint mehr von dem Abend in Erinnerung behalten zu haben als ich. Er sagt, dass er die Frau von der Tanzfläche mit nach Hause genommen hat. Mich hat er die ganze Nacht nicht mehr gesehen. Aber wir hätten noch telefoniert. Gegen 5 Uhr morgens. Er meint, dass er mich kaum verstanden hat. Ich habe gefaselt, dass ich mein Herz wieder gefunden habe und dass ich es nur schnell mit dem Auto abholen würde. Dann habe ich gesagt, dass ich am Strand wäre. Danach aufgelegt. Das sind erst einmal genügend Informationen die ich verarbeiten muss. Danke Julian. Ich melde mich. Irgendwie fühle ich mich ein wenig erleichtert. Zumindest ein wenig. Vielleicht bin ich ja nur mit dem Auto an der Tankstelle vorbei und dann gleich zum Spielplatz, das wären nur ca. 500 Meter. Da ist bestimmt nichts passiert. Aber das bleibt abzuwarten. Abzuwarten ob die Polizei sich die nächsten Tage bei mir meldet. Ich gucke kurz durch einen Spalt zwischen den Jalousien. Die Sonne scheint. Die Blumen blühen in prächtigen Farben. Im Hinterhof spielen Kinder im Planschbecken. Im Schatten unter dem großen Baum sitzen die Eltern, grillen Würstchen und Steaks, spielen Gitarre und unterhalten sich. Alles wirkt so warm und einladend. Nur nicht für mich. Ich verkrieche mich in mein Bett. Ich könnte heulen. Das Telefon klingelt wieder. Unbekannter Anrufer. Diesmal nehme ich ab. Am anderen Ende der Leitung grüßt eine freundliche Frauenstimme. Es ist Elli.
Der Traum
von Sarah Kosel
Es ist spät am Abend. Eine unheimliche Stille verbreitet sich in den Räumen ihres Hauses. Das Haus, das sie ihr Zuhause nennt. Doch ist es das wirklich?
Sie bemerkt das leise Atmen ihres Mannes, der neben ihr im Bett liegt und schläft.
Vorsichtig öffnet sie die Schublade ihres Nachtschrankes und greift nach der mit der Zeit gelbgewordenen Postkarte. Durch das schwache Licht der Nachttischlampe erscheint sie ihr fremd. Sie liest. Sie liest sie nahezu zehn Mal.
Plötzlich spürt sie einen stechenden Schmerz, der sich durch ihren Körper zieht. Traurig und mit Tränen in den Augen legt sie sich zu ihrem Mann. Sie macht das Licht aus und schläft ein.
Die Zeitreise beginnt. Sie geht zurück in das Jahr 1962, das ihr Leben von Grund auf verändert hat.
Es begann im August des Jahres 1962. Sofie und ihr kleiner Sohn Benjamin verbrachten ihren Urlaub in Kamienny Potok, in einem wunderschönen Badeort bei Sopot in Polen. Sofie war eine bildschöne Frau. Sie war klein und zierlich. Sie trug bezaubernde Kleider, die zu ihrem ebenholzfarbenen Haar passten. Einige Männer drehten sich nach ihr um, denn sie verstand es, sie mit einem Blick zu verzaubern.
Die Trennung von ihrem Ehemann und die ständigen Versprechungen seinerseits, die sich in Luft auflösten, sobald man sich wieder näher kam, brachten Sofie dazu, einfach loszufahren. Ohne lange zu überlegen, einfach loszufahren.
Es war ein heißer Sommer. Überfüllte Strände und Strandcafes, wo auch immer man hinsah.
Das laute Kinderlachen ihres Sohnes und das Gefühl der Selbstständigkeit gaben ihr in der schweren Zeit Kraft.
Alles war neu und fremd. „Es war Zeit für einen Neuanfang“, dachte sie. Und so geschah es.
Es war ein besonders heißer Augusttag. Sofie und Benjamin vergnügten sich am Strand. Er war hoch beschäftigt mit dem Bau seiner Sandburg und sie las vertieft in ihrem neuen Buch. Die Zeit verging wie im Flug. Der Wind pustete ihr eine Strähne, die sich aus ihrem Pferdeschwanzzopf löste, ins Gesicht. Mit Mühe spähte sie nach ihrem Kind. Sie sah es nicht mehr. Schnell ließ sie ihr Buch fallen, das wie ein Stein zu Boden fiel und rannte los. Verzweifelt suchte sie ihn überall, doch niemand hatte ihn gesehen. Schnell packte sie ihre Sachen zusammen, als sie plötzlich jemand am Arm zog. Erschrocken dreht sie sich um. Benjamin stand Hand in Hand mit einem dunklen, fremden Mann vor ihr. Sofie nahm ihn in den Arm und sagte: „ Ich habe mir solche Sorgen gemacht, wo bist du gewesen?“. Ihr Atem stockte noch immer. Benjamin entgegnete: „ Ich wollte nur etwas Wasser holen und dann….“
„Guten Tag“, unterbrach der Unbekannte mit ängstlicher Stimme.„Guten Tag“, antwortete Sofie.
Sie spürte eine unbeschreibliche Wärme, die von dem Unbekannten ausging. „Wie kann ich ihnen jemals dafür danken?“, fragte sie ihn. Doch er schüttelte nur den Kopf.
Josua, so hieß er, wie sich nach langen Kommunikationsversuchen herausstellte, kam aus einer reichen Architektenfamilie aus Indonesien und studierte in Sopot. Er sprach nur gebrochen polnisch, sodass die Verständigung mit Händen und Füßen erfolgte. Sie setzten sich in ein Cafe und unterhielten sich. Sie sprachen über Gott und die Welt. Obwohl sie sich erst wenige Minuten kannten, fühlten sie sich einander vertraut.
Amors Pfeil ging direkt in beide Herzen. Stunden vergingen. Langsam wurde es dunkel und der kühle Meereswind brachte die Bäume zum Rascheln. Vorsichtig legte Josua seine Jacke über Sofies Schultern. „Sehen wir uns morgen wieder?“, fragte er zögernd. Sofie sah zu ihm hoch und nickte. Sie bedankte sich für den wunderschönen Abend, nahm Benjamin, der gerade den Wassergraben seiner Sandburg aushob, an die Hand und ging. Nach ein paar Schritten, drehte Sofie sich noch einmal um und lächelte Josua zu. Dann verschwanden sie. Es verging kein Tag, an dem sie sich nicht trafen. Wochen vergingen wie Minuten.
Benjamin sah in Josua eine Art Ersatzvater. Er war liebevoll, geduldig, warmherzig und sie verbrachten viele fröhliche Stunden miteinander. Das, was sein leiblicher Vater nicht tat. Denn er war stets betrunken, randalierte im Haus und schlug ihn und seine Mutter. Das plötzliche Gefühl von Liebe, Zuwendung und Interesse ließen Benjamin völlig aufblühen.„Ist das jetzt mein neuer Papa“, fragte er seine Mutter jeden Tag vor dem Zu- Bett-Gehen. Doch sie wusste keine Antwort, zumindest keine, die der Kleine verstehen würde. Für sie war jeder neue Tag mit Josua ein Geschenk und gleichzeitig eine Überraschung. Romantische Strandspaziergänge, Abendessen und aufregende Ausflüge. Sie wusste nicht, was er sich wohl als nächstes einfallen lassen würde, um die Stunden und Tage so unvergesslich und schön wie nur möglich zu machen.
Vier Wochen später reisten Sofie und Benjamin ab. Die Trennung gelang ihnen nur schwer. Josua versprach, den Kontakt so gut es gehen würde aufrecht zu erhalten.
„Josua, Josua“, schrie Benjamin mit lauter Stimme, als sie nach einer langen, innigen Umarmung in den Zug stiegen, „Ich will zurück zu Josua“. Er war noch viel zu klein, um das alles zu verstehen. Mit weinenden Augen blickte er Josua an, der langsam auf ihn zukam. Mit Mühe reichte er Benjamin etwas durch das Zugfenster. Es war eine kleine Truhe. Sie war mit zahlreichen Farben und Steinen verziert und sah schon sehr alt aus. Vorsichtig öffnete Benjamin sie und zum Vorschein kam ein kleines, rotes Auto. Er hatte noch nie so etwas Schönes bekommen, deshalb war es für ihn etwas ganz besonderes. Die Türen schlossen sich und der Zug fuhr los. Benjamin hielt sein rotes Auto fest in seinen kleinen Händen. Sofie blickte zu Josua. Nach einigen Sekunden war er kaum noch zu sehen, bis er schließlich ganz verschwand.
Seit der Trennung von ihrem Ehemann lebte Sofie wieder im Haus ihrer Eltern.
Sie erzählte ihnen nicht von ihrer Begegnung mit Josua, weil sie wusste, dass diese auf Ablehnung gestoßen wäre. Auch Benjamin wusste, dass er niemandem von ihm erzählen durfte. Er vermisste ihn so schrecklich und fragte seine Mutter ständig nach ihm. Er verbrachte viele Stunden alleine in seinem Zimmer und spielte nur mit dem kleinen, roten Auto.
Sofies plötzlicher Einzug bei ihren Eltern sorgte für viel Gesprächsstoff und brachte gleichzeitig Schande über die Familie. Trotz allem, brach sie den Kontakt zu Josua nicht ab.
Sie schickte ihm die Adresse von ihrer Freundin Amelie, damit niemand davon erfuhr.
Amelie wohnte alleine und war die einzige, die von Josua wusste. Doch sie verstand Sofie nicht. Sie begriff nicht, wieso Sofie alles daran setzte, nur um den Kontakt zu ihrer Urlaubsliebe aufrecht zu erhalten. Amelie war der Meinung, die Beziehung wäre zum Scheitern verurteilt. „Sofie, eure Beziehung hat keine Zukunft“, waren die Worte, die täglich fielen.
Doch irgendetwas im Inneren des Körpers brachte Sofie dazu. Es war nicht nur die Liebe und Sehnsucht, die sie empfand. Es war ein Gefühl, das sie kannte, das aber andererseits völlig fremd war. Sie konnte es nicht beschreiben. Es war etwas, das sie zum Lachen und im nächsten Augenblick zum Weinen brachte. Es war etwas, das ihr die Kraft gab Berge zu versetzen. Es war ein wunderbares Geschenk. Sofie erwartete ein Kind.
Der Schriftverkehr zwischen Josua und Sofie wurde intensiver. Eilig machte sich Sofie Tag für Tag auf den Weg zu Amelie. Gespannt wartete sie am Wohnzimmerfenster auf den Postboten. „ Er ist da“, schrie Sofie und rannte ihm schon entgegen. Sie riss ihm den Brief aus der Hand und öffnete ihn.
„Geht es euch gut?“, war die erste Frage jedes Briefes.
Immer wenn sie seine Briefe las, fühlte sie ihn, als sei er ganz nah bei ihr. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als das, doch die Aussichten waren schlecht.
Sie versuchten eine Möglichkeit zu finden. Eine Möglichkeit, um sich wieder zu sehen und um ein gemeinsames Leben aufzubauen. Beide wussten, dass die Rückreise in das kommunistische Indonesien der totale Kontaktabbruch bedeuten würde. Ihnen blieb nicht mehr viel Zeit.
Wochen und Tage vergingen. Sofies Bauch wuchs nur langsam, er war kaum zu sehen.
Endlich erhielt sie wieder einen Brief. Es erschien ihr wie eine Ewigkeit, als sie das letzte Mal von Josua hörte. Ein winziger Hoffnungsschimmer erleuchtete. Er lud sie zu einer Silvesterfeier im Warschauer Palast ein. Die indonesische Botschaft und alle indonesischen Studenten waren eingeladen und durften eine Begleitperson mitbringen.
Josua beabsichtigte durch Kontakte und Freundschaften, die sich Silvester ergeben würden, ein Visum für Sofie und Benjamin zu bekommen.
Sofie wusste, dass es ihre einzige und zugleich letzte Chance war, denn das Schiff, das alle Studenten zurück nach Indonesien bringen sollte, stand schon im Hafen von Sopot. Der Aufbruch war für den 3. Januar geplant.
Sofie zögerte nicht. Ohne lange zu überlegen, stieg sie in den Zug in Richtung Warschau.
Sie war voller Glück endlich ihren Liebsten wieder zu sehen, dass sie im Zug keine Minute still sitzen konnte.
Josua holte sie vom Bahnhof ab. Der Zug erreichte langsam den Bahnsteig. Nach einem lauten Bremsen öffnet der Zug die großen, schweren Türen. Sofie fiel Josua in die Arme. Sie weinte bitterlich, als sie den bebenden Köper von Josua spürte. „ Ich habe dich so sehr vermisst“, sagte sie mit einer weinerlichen Stimme. Josef hielt sie fest in seinen Armen. „Ich liebe dich“, flüsterte er ihr leise ins Ohr. Er sah ihr tief in die Augen, strich ihr sanft durchs Haar und küsste sie. Es waren bereits fünf Monate seit dem Abschied in Sopot vergangen. Fünf lange Monate, die beiden wie eine Ewigkeit vorkamen. Es waren Monate ohne seine zärtlichen Küsse, seine Umarmungen und seine Liebe. Langsam schlenderten sie zum Ausgang. Das Taxi wartete schon.
Josua verstaute ihr Gepäck im Kofferraum und stieg ein.
Sofie war sehr offen und umgänglich. Sie verstand sich mit allen auf der Feier; lernte viele neue Menschen, Sitten und Gebräuche kennen und hatte viel Spaß. Es war eine fremde Kultur, ein fremdes Land, doch alle waren so freundlich und schlossen sie gleich ins Herz. „Noch ein Stück Kuchen, Sekt oder Häppchen?“ riefen die Frauen ihr zu. Sofie bewunderte sie.
Sie bewunderte die bunten, langen Kleider, die sie trugen. Sie besaßen wertvollen Schmuck, der so prachtvoll war, dass er schon aus weiter Entfernung funkelte. Die neue Welt gefiel Sofie.
Sie war frei und unbeschwert. „Darf ich um diesen Tanz bitten?“, fragte Josua und hielt ihr seine Hand hin. „Nichts lieber als das“, antwortete Sofie und zwinkerte ihm zu.
Die Musik spielte nur für sie. In ihren Gedanken zog das zukünftige Leben an ihnen vorbei. Ein Leben, in dem Trauer und Schmerz ein Fremdwort waren.
Sie tanzten. Für einen kleinen Moment vergaßen sie all ihre Sorgen und Ängste. Sie waren frei.
Es war null Uhr. Die Musik wurde leiser und leiser, bis sie nur noch schwach im Hintergrund zu hören war.
Sofie kehrte in die Wirklichkeit zurück. Sie dachte an ihre Familie, ihre Eltern, Geschwister und Freunde, die sie für immer verlassen müsste. Sie wurde traurig. Doch eine andere Möglichkeit gab es nicht.
Die Menschenmenge eilte nach draußen. Josua und Sofie suchten sich einen ruhigen Platz und setzten sich auf eine mit Rosen verzierte Bank. Bunte, helle Lichter erfüllten den Himmel. Die Nacht wurde zum Tag. Plötzlich ließ Josua Sofies Hand los und holte eine kleine Schachtel aus seiner Tasche. Er öffnete sie und holte einen goldenen Ring heraus. Sofie stockte der Atem. Behutsam streifte Josua ihr den Ring auf den Finger und sagte: „Dies ist ein Zeichen meiner Liebe, egal was die Zukunft bringen mag, mit diesem Ring ist ein Teil von mir immer in deiner Nähe.“
Sofie antwortete mit leiser Stimme „Sag so etwas nicht, versprich mir, dass du immer bei mir bleibst.“ Erwartungsvoll blickte sie ihm in die Augen.
Josua entgegnete: „ Ja.- Ja, ich verspreche es.“ Behutsam nahm er ihre Hand und küsste sie.
Das Lichtermeer wurde immer kleiner. Die Menschenmenge begab sich wieder in den Saal und auch Josua und Sofie folgten ihnen.
Die Silvesterfeier näherte sich dem Ende. Auf dem Nachhauseweg unterhielt sich Josua mit einer Gruppe älterer Männer und suchte bei ihnen Hilfe. Sie gehörten der indonesischen Botschaft an. Sie baten Josua um ein wenig Bedenkzeit und vereinbarten ein Treffen am
2. Januar.
Die Zeit des Wartens zerrte an die Nerven der Liebenden. Es ging um alles. Um ihre gemeinsame Zukunft, um das Baby, einfach um alles. Schlaflose Nächte mit Gesprächen bis tief in die Nacht vergingen nur langsam.
Doch endlich war es soweit. Da war er, der Tag, der alles entschied.
„Was wäre wenn?“, fragte Sofie immer wieder, als sie auf dem Weg zur Botschaft waren.
Josua hatte keine Antwort. Er versuchte sie zu beruhigen und sprach ihr Mut zu. Mut, den er selber nur vorgab zu besitzen.
Sie saßen in einem kühlen Raum. Es war niemand da. Nur das laute Ticken einer großen Wanduhr war zu hören. Es klang wie ein Schuss, dem mit Abstand weitere Schüsse folgten. Schüsse, die jegliches Leid beenden könnten.
Plötzlich öffnete sich die Tür. Ein alter, dunkler Mann trat herein. Er hatte ein freundliches Lächeln und trotzdem wirkte er bedrückt und traurig. Er stellte sich vor. Ein lautes Knarren erfüllte den Raum, als er auf seinem Holzstuhl Platz nahm. Sofies Herz schlug bis zum Hals. Josuas zittrige, kalte Hand griff nach ihr. „Es wird alles gut“, sagte er mit ängstlicher Stimme.
Der alte Mann begann leise zu reden. Er sprach mit Josua indonesisch. Sekunden, Minuten, ja sogar Stunden, wie Sofie es empfand, vergingen. Dann wurde es ruhig.
Josua neigte den Kopf nach unten. Sofie sah die Träne, die über seine Wange rollte und auf seine Hose tropfte. Er drehte sich zu ihr und nahm sie fest in den Arm.
In dem Moment wusste sie, dass sich morgen ihre Wege trennen würden und was zurückbleiben würde, die nur die Erinnerung an einen wunderbaren Menschen und an eine wunderbare Zeit war. Eine Zeit, die ihr an schweren Tagen Kraft gab und die sie sehr vermissen würde.
Ihre Augen waren leer. Die Welt, die sie sich gemeinsam aufbauen wollten, brach in nur einer Sekunde zusammen. Sofie starrte dem alten Mann tief in die Augen. Tausend Gedanken gingen ihr durch den Kopf. Sie wollte ihn soviel fragen, doch sie brachte kein Wort heraus. Sie war wie gelähmt.
„Es tut mir leid“, sagte der alte Mann und durchbrach somit die Stille des Raumes. Sofie und Josua reagierten nicht auf seine Worte. Ohne ein Wort zu sagen, verließen sie den Raum.
Sie waren blass. Sie setzten sich eng umschlungen auf eine Bank. Sofie bebte am ganzen Körper. Sie konnte und wollte das alles nicht verstehen. „Warum?“, schrie sie immer wieder. Sie konnte sich ein Leben ohne Josua nicht vorstellen, doch sie hatte keine andere Wahl, das Visum wurde abgelehnt.
Josua versuchte in den letzten Stunden, die ihnen noch blieben, stark zu sein. Doch jeglicher Versuch scheiterte.
Sie irrten durch die leeren Straßen Warschaus. Sie hatten kein Ziel. Alles wurde ihnen weggenommen.
Am 3. Januar sahen sich Sofie und Josua zum letzten Mal.
Er brachte sie zum Bahnhof. Draußen herrschte eine eisige Kälte. Josua, der nur eine dünne Jacke trug, zitterte am ganzen Körper. Dies war ihr zweiter Abschied, doch diesmal war er für immer. Sie gab ihm den letzten Kuss und sah ihm dabei tief in seine Augen. Jener Anblick, der sich in ihrem Herz und in ihren Gedanken verewigte.
„Ich werde euch immer lieben und niemals vergessen“, sagte Josua mit trauriger Stimme.
Sofie nickte zaghaft und wischte sanft eine Träne von Josefs Wange.
Sie stieg ein. Die Scheiben des Zuges waren zugefroren. Mit all ihrer Kraft pustete Sofie ein kleines Loch frei und blickte hindurch. Verlassen stand Josua auf dem kahlen, düsteren Bahnsteig. So nah und doch so fern.
Der Zug, gab ein lautes Geräusch von sich und fuhr los. Sofie weinte. Sie dachte an all die Momente, in denen sie so glücklich waren. Ihr Blick fiel auf den goldenen Ring an ihrem Finger. Sie streifte ihn ab und sah ihn sich genau an. Sie bemerkte eine Gravur im Inneren des Ringes. In winziger Schrift war der Name Jonathan eingraviert. Sie schaute zu Josua. Er lächelte und warf ihr eine Kusshand zu. „Ich liebe dich“, flüsterte Sofie leise.
Josua stand verlassen am kahlen, düsteren Bahnsteig. Er wurde immer kleiner und kleiner, bis er vollständig in der Ewigkeit verschwand.
Sie wacht auf. Die Morgensonne scheint durch das fast zugezogene Fenster. Inzwischen sind 44 Jahre vergangen.
Sie erinnert sich an die Geburt ihres zweiten Sohnes Jonathan im Mai 1963, an die Scheidung von ihrem Ehemann und an die spätere Flucht nach Deutschland, wo sie ihren zweiten Mann kennen lernte.
Der Brief, den Sofie kurz nach der Geburt schrieb, erreichte Josua nicht und auch die polnische Botschaft verweigerte jegliche Hilfe.
Das letzte Lebenszeichen war eine Postkarte, die Josua auf dem Weg nach Indonesien in Deutschland abschickte.
Die Reise mit der Seifenblase
von Kerstin Voß
Auf einer großen grünen Wiese saßen die Hasen Daniel, Hoppel, Schleuderohrenhasi und die beiden lieben Gespenster Weißfleck und Drecki. Sie saßen alle um den selbst gebauten Teich herum. Auf einmal kam Paapir, ein kleiner schwarzer Panda, hinzu. Alle schauten ihn mit großen Augen an, da er ganz weiße und schaumige Pfoten hatte. „Was hast du denn mit deinen Pfoten gemacht?“ fragte Schleuderohrenhasi aufgeregt. „Ich habe mit riesengroßen Seifenblasen gespielt. Und wisst ihr, wie viele Seifenblasen ich gefangen habe?“, fragte Paapir stolz. „Paapir, du bist so gut und schnell, dass du bestimmt ganz viele Seifenblasen gefangen hast“, antwortete Schleuderohrenhasi. „Ja“, rief Paapir, „ich habe es geschafft, in einer Minute dreißig Seifenblasen zu fangen!“. -„Das ist echt super! Darf ich auch mal mit den Seifenblasen spielen?“, fragte Schleuderohrenhasi. -„Weißt du was, Schleuderohrenhasi, ich habe doch noch etwas Schaum an meinen Pfoten und wenn ich die in den Teich tauche und ganz schnell bewege…“ „Ja“, platze Schleuderohrenhasi heraus, „dann gibt es ganz viele Seifenblasen.“ „Richtig!“, sagte Paapir. Gesagt, getan ging er zum Teich und hielt seine beiden vorderen Pfoten in das Wasser.
Schleuderohrenhasi hüpfte schon ganz aufgeregt hin und her. Dabei rief er, „gleich gibt es Seifenblasen!! -Jaaaaa, gleich ist es soweit!!“
Plötzlich blieb Schleuderohrenhasi ganz erstarrt stehen und staunte: „Boah, sind die aber groß, Paapir“. „Habe ich gut gemacht, oder?“ sagte Paapir stolz. „Ja, und diese wunderschönen Farben! Lila, rot, gelb, grün, blau, orange und wie sie glitzern!, rief Schleuderohrenhasi ganz aufgeregt. Schleuderohrenhasi war so sehr erstaunt, das seine langen Ohren ganz starr nach oben standen.
„Jetzt geht es los, geht es los!“ rief Paapir laut mit erhobenen Pfoten! Du fängst alle blauen, grünen und gelben und ich alle roten, orangen und lila Seifenblasen.“ „Warte“, rief Schleuderohrenhasi, „wollen wir die anderen fragen, ob sie auch mitspielen wollen? -„Oh ja, das ist eine sehr gute Idee!“ So gingen Paapir und Schleuderohrenhasi zu den beiden Hasen Daniel, Hoppel und zu den beiden lieben Gespenstern Weißfleck und Drecki, um sie zu fragen.
„Ach nee!“ maulten die beiden Hasen und Gespenster gelangweilt. Wir haben heute keine Lust zu spielen, wir wollen lieber in der Sonne liegen, Schleuderohrenhasi.“ -„Na gut, dann fangen Paapir und ich alle Seifenblasen alleine.“
Schleuderohrenhasi war immer noch so sehr erstaunt, das seine Ohren ganz starr und steif nach oben zeigten. „Jetzt geht es los!“, rief Paapir. „Ja“, sagte Schleuderohrenhasi „ich bin schon startklar“.
Nun versuchten die beiden so schnell wie möglich ganz viele Seifenblasen einzufangen. Schleuderohrenhasi fing die Seifenblasen mit seinen langen Ohren und begann dabei ganz schnell hin und her zu hüpfen. Paapir dagegen nahm einen großen Anlauf und legte dann einen turbo-schnellen Flug und eine turbo-schnelle Landung hin. Jedes Mal, wenn Paapir eine Seifenblase gefangen hatte rief er: „Ja, ich habe schon wieder eine!“.
Plötzlich, stellte Schleuderohrenhasi fest „Oh, es sind ja gar keine Seifenblasen mehr da!! Paapir schaute Schleuderohrenhasi wie versteinert an. „Was ist denn nun wieder, Schleuderohrenhasi? Warum machst du denn so großen Augen?“ „Hihihi!“ Paapir lachte ganz laut und klopfte sich dabei mit dem Pfoten auf die Brust. „Was ist denn?“, wunderte sich Schleuderohrenhasi. „Weißt du, wie du aussiehst?“ – „Na, klar, wie ein Hase natürlich, wie denn sonst?“ – „Nein, das meine ich nicht. Deine Ohren und deine Vorderpfoten sind auch ganz schaumig, wie meine Pfoten. Das sieht wirklich lustig aus!“
Schleuderohrenhasi ging zum Teich, um sich selbst im Wasserspiegel zu sehen. „Ja, du hast Recht Paapir, die sind ja wirklich ganz weiß vor Schaum!“ „Ja, habe ich dir doch gesagt!“
„Weißt du, was wir machen können?“ Schleuderohrenhasi flüsterte: „Wir können ein riesen-, riesengroßes Schaumbad machen! Mal sehen, was die anderen Tiere dazu sagen werden!“
So sprangen Paapir und Schleuderohrenhasi in den selbst gebauten Teich. Als die beiden wieder auftauchten, sahen und hörten sie es blubbern. „Hast du gepupst?“, fragte Paapir. „Nein, habe ich nicht“. – „Aber warum kommen dann auf einmal Blasen, fragte Paapir ungläubig.
Plötzlich tauchte das liebe Seemonster mit seinen schwarz gelb gestreiften Körper auf. „Was habt ihr denn mit meinem Teich gemacht? Da sind ja überall Seifenblasen,“ fragte das liebe Seemonster. „Wir haben Seifenblasen jagen gespielt.“
„Wollt ihr mal eine ganz große Seifenblase sehen?“, fragte das liebe Seemonster. „Na, klar!“ sagten Schleuderohrenhasi und Paapir wie aus einem Mund.
Das Seemonster bewegte sich im Wasser auf und ab. Auf einmal tauchte unter Schleuderohrenhasi und Paapir eine große Seifenblase auf.
„Ohhhh!“ entfuhr es Paapir mit freudiger und zitternder Stimme. Genau im diesem Moment ploppte es und Schleuderohrenhasi und Paapir waren gemeinsam in der großen bunten Seifenblase gefangen. „Schau mal, Schleuderohrenhasi, wir heben ab! -„Wir müssen ganz leise sprechen und dürfen uns nur wenig bewegen, damit die Seifenblase nicht platzt“, sagte Schleuderohrenhasi aufgeregt. „Ja, du hast Recht, flüsterte Schleuderohrenhasi ganz leise.
Die Seifenblase stieg immer höher und höher in den blauen Himmel hinauf. Zuerst flogen Paapir und Schleuderohrenhasi durch eine ganz riesengroße weiße Wolke. Als sie die Wolke durchflogen hatten, erblickten sie die große grüne Wiese mit dem selbst gebauten Teich und den anderen Tieren. Am besten konnte sie wegen dem strahlenden gelben und schwarzen Streifen das liebe Seemonster erkennen. Danach entdeckten sie Daniel, weil er besonders groß war.
Daniel und Hoppel und die beiden lieben Gespenster, die immer noch am Teich saßen, schauten der Seifenblase erstaunt nach bis diese immer kleiner und kleiner wurde und schließlich nicht mehr am Himmel zu sehen war.
Als nächstes flogen Paapir und Schleuderohrenhasi durch den Wald. Dort angekommen sahen sie das Baumhaus von Weißfleck und Drecki. Als sie weiterflogen, sahen sie den langen Fluss, in dem sich der Biber Langzahn sein Zuhause gebaut hatte.
Auf einmal bemerkten sie, wie ein grüner Baum umfiel. „Ach“, sagte Paapir „Langzahn muss bestimmt sein Haus reparieren“. – „Ja, das glaube ich auch“, sagte Schleuderhorenhasi, „bestimmt, weil es soviel geregnet hat in der letzten Zeit.“ Sie winkten ihm und stiegen höher und höher, bis sie die Bäume nur noch als grüne Punkte erkennen konnten.
Plötzlich kam ein so starker Windstoß, dass sich die Seifenblase drehte und drehte. Paapir und Schleuderohrenhasi wurden in der Seifenblase hin- und hergewirbelt. Als sie ihre Augen wieder geöffnet hatten, sahen sie die beiden lieben Gespenster Weißfleck und Drecki. „Vielen Dank, dass ihr uns gestoppt habt“, sagte Paapir vorsichtig.
Schleuderohrenhasi hatte noch leicht grüne Ohren, die jetzt aber schlapp nach unten hingen. „Alles in Ordnung mit dir Schleuderohrenhasi“, fragte Paapir leise. „Ja, es geht schon wieder, aber ich bin ganz schön durchgeschleudert worden, antwortete Schleuderohrenhasi mit leiser Stimme.
„Warum wart ihr denn hier“, fragte Paapir die beiden lieben Gespenster. „Ihr wart doch, als wir losgeflogen sind, noch bei Hoppel und Daniel am Teich.“ „Ja, das stimmt, aber wir wollen uns jetzt noch den großen Schmetterlingschwarm anschauen, der gleich genau hier lang fliegt. Deshalb müsst ihr schnell zur Seite fliegen!“ -„Aber wir können die Seifenblase doch gar nicht steuern. -„Stimmt ja, sagte Weißfleck. Dann schieben wir euch ganz vorsichtig bei Seite.“
Gerade als die Seifenblase mit Paapir und Schleuderohrenhasi bei Seite geschoben war, hörten sie schon das Schlagen der Schmetterlingsflügel. „Sie kommen gleich“, rief Drecki, der sich schon wieder schmutzig gemacht hatte.
Als der Anführer Schmetterling in Weißflecks Augenhöhe war, rief Weißfleck: „Lieber, großer, bunter Schmetterling, würdest du mit deinen vielen Freunden etwas tiefer fliegen?“ –„Warum denn?“, fragte der große bunte Schmetterling. „Dann können dich und deinen schönen Schwarm auch die anderen Tiere, die unten am Teich sitzen, sehen.“ „Meist du, dass sie uns so nicht sehen können?“ -„Nein, weil so viele Wolken aufgezogen sind“. -„Gut das machen wir.“ Der große Schmetterling drehte sich um, stellte seine Fühler auf und rief: „Gut zugehört und aufgepasst, wir fliegen etwas tiefer, damit uns alle sehen können. Denkt nur alle daran, dass gleich eine große Flugstraße kommt, an der wir gut nach rechts und nach links und dann wieder nach rechts schauen müssen!“
„Ja, wird gemacht!“ riefen die anderen bunten Schmetterlinge zurück. So setzte sich der riesengroße Schmetterlingschwarm in Bewegung. Als Schleuderohrenhasi und Paapir zwischen ihre Füße und durch den Boden der Seifenblase schauten, sahen sie manche Schmetterlinge von oben. Schleuderohrenhasi war ganz erstaunt: „Schau mal Paapir, was die Schmetterlinge für schöne Farben haben! Lila, rot, blau, gelb und manche haben sogar schwarze Punkte auf ihren Flügeln!“
„Oh-Oh“, machte Schleuderohrenhasi auf einmal. „Oh-Oh“ machten auch die beiden lieben Gespenster. „Eure Seifenblase wird in der Mitte ganz dünn.“ „Ohhh“, machte dann auch Paapir. „Daran habe ich gar nicht mehr gedacht! Das liebe Seemonster hat doch gerufen, dass die Seifenblase nur so lange hält, bis der Schmetterlingschwarm vorbeigezogen ist! Helft ihr uns, Dreckig und Weißfleck, dass wir wieder schnell auf die große grüne Wiese kommen?“ Die beiden Gespenster antworteten nicht, sondern schoben die Seifenblase sofort in Richtung der grünen Wiese.
„Schneller, schneller!“ riefen Paapir und Schleuderohrenhasi gleichzeitig. „Ja doch!“ Wir beeilen uns ja schon. Es ploppte und die Seifenblase verschwand vor ihren Augen.
Schleuderohrenhasi und Paapir flogen noch mit Hilfe von Weißfleck und Drecki zurück auf die große grüne Wiese.
„Puhh, das war knapp!“, sagte Schleuderohrenhasi und Paapir nickte nur. „Kommt ihr auch wieder mit zum Teich?“, fragten Weißfleck und Drecki. „Na klar“, sagten Schleuderohrenhasi und Paapir, „das machen wir gerne.“
Als sich die vier auf den Weg machten, wurde es schon etwas dunkel. Von weiten sahen sie schon, dass Daniel und Hoppel Kerzen angezündet hatten. Auch erspähten sie die Ente Kuschelduck, die gerade ihre Federn putzte. „Das ist aber schön, dass Kuschelduck auch noch gekommen ist“, sagte Paapir. „Ja, das finden wir auch“, sagten Weißfleck, Drecki und Schleuderohrenhasi.
Als sie angekommen waren, sprang Daniel auf einmal auf und rief: „Wisst ihr eigentlich, wie spät es schon ist?“ Alle Tiere starrten Daniel erstaunt an. „Bestimmt noch nicht so spät, wir haben doch gerade erst angefangen am Teich zu spielen“, meinte die Ente Kuschelduck. „Hört gut zu, es ist schon acht Uhr und längst Bettgehzeit.“ „Jaaa, du hast recht Daniel“, sagten alle Tiere fast gleichzeitig und mit leiser Stimme. Alle waren einwenig traurig, da sie noch gern weitergespielt hätten, aber sie packten dennoch ihre Sachen ein, um aufzuräumen. Dabei freuten sie sich schon auf den nächsten Tag, an dem sie wieder gemeinsam spielen können.
Zuerst tauchten das liebe Seemonster und die Ente Kuschelduck, in ihr Wasserzuhause ab. Alle schauten ihnen nach. Nach und nach ging auch das liebe Seemonster langsam unter. Zuletzt sah man nur noch seinen gelb schwarzen Schwanz. Als auch dieser verschwunden war, machten sich die Tiere auf den Weg nach Hause.
Schleuderohrenhasi, Daniel und Hoppel hoppelten zurück in ihre Höhle unter der Erde. Paapir, Weißfleck und Drecki ging zurück in den Wald.
Paapir kletterte auf seinen Schlafbaum und Weißfleck und Drecki flogen in ihr Baumhaus zurück. Auch der fleißige Biber Langzahn tauchte zurück in seine Holzwohnung. Als er zu Hause angekommen war, schüttelte er das Wasser ab und ging in das Biberbadezimmer.
Fast gleichzeitig putzen sich alle Tiere die Zähne, gingen auf die Toilette und zogen sich den Schlafanzug an. Danach legten sie sich alle in das kuschelige warme Bett. „Ach“, dachten sie, „war das ein schöner Tag!“
Dabei merkten sie, dass ihre Arme ganz schwer wurden. Auch die beiden Beine wurden nach und nach schwerer und schwerer. Sogar die Füße wurden ganz schwer und müde. Auch die Augen gingen nach und nach ganz langsam zu. Und der Kopf der heute soviel denken musste, wurde ganz schwer. So schliefen alle Tiere ein. Und träumten von diesem wunderschönen Tag, den sie alle gemeinsam erlebt haben. „Gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes!“, wünschte Schleuderohrenhasi allen anderen Tieren.
Bilder aus Unterricht und Präsentation







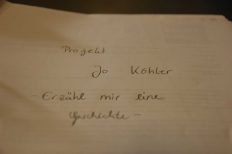

















Presse